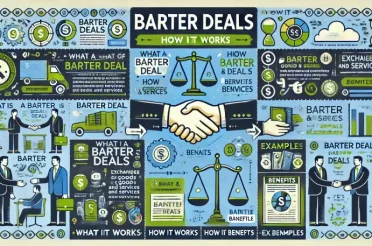Das Geheimnis der Sprache
Deutsch ist nicht gleich Deutsch. Die deutsche Sprache, mit der in Deutschland geschrieben und gesprochen wird, unterscheidet sich in vielen Punkten von der in der Deutschschweiz. Wenn Sie mit diesem Wissen Ihre Website optimieren, ist das genau das gewisse Etwas, mit dem Sie herausstechen.
 Bild: Klaus Dieter vom Wangenheim auf Pixabay
Bild: Klaus Dieter vom Wangenheim auf Pixabay
In der Deutschschweiz, der Westschweiz oder im Tessin unterscheiden sich die Schweizer Sprachgewohnheiten von jenen unserer Nachbarländer. Der Deutsche und der Deutschschweizer verstehen sich zwar, und doch gibt es zahlreiche sprachliche Unterschiede, die darüber entscheiden, ob Sie den Kunden für Ihr Unternehmen gewinnen oder ihn vor den Kopf stossen. Diesen Aspekt sollten Sie auch bei Ihrer Website beachten.
Kundennutzen Insider-Abo und Bibliothek
Erhalten Sie alle 7 bis 14 Tage aktuelle Insider-Tipps und Tricks sowie frisch entdeckte leistungsfähige und zeitsparende Online-Tools direkt ins eigene Postfach. Zudem erhalten Sie Zugriff auf den Mitgliederbereich mit 28 E-Books rund um das Thema Ihres Internetauftritts!
Eine Übersetzung von Marketingtexten auf Ihrer Website bringt Ihren Kunden keinen Mehrwert, wenn sie bloss die Wörter, Wendungen und Sätze der Ausgangssprache durch diejenigen der Zielsprache ersetzt. Um Ihren Umsatz mithilfe von Marketingtexten in fremden Märkten zu erhöhen, müssen die übersetzten Texte die potenziellen Kunden auch wirklich ansprechen, d.h. sie müssen die lokalen und kulturellen Gegebenheiten berücksichtigen. Das leuchtet zweifellos ein. Aber wie verhält es sich innerhalb der gleichen Sprache? Die deutsche Sprache beispielsweise wird in Deutschland, Österreich, der Schweiz, in Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien, Südtirol, Elsass und Lothringen sowie von Minderheiten in weiteren mitteleuropäischen Ländern gesprochen und geschrieben. Die französische Sprache wird ihrerseits in der Schweiz (über 20%), in Frankreich, Belgien, Luxemburg, Kanada, West- und Zentralafrika und anderen Regionen gesprochen. Dass diese Vielfalt an Ländern und Regionen keinen homogenen Raum bildet, liegt auf der Hand, und entsprechend erheblich sind denn auch die Unterschiede in der Sprache, auch in der geschriebenen. Nicht anders verhält es sich mit dem italienischen Sprachgebrauch.
Die Schweizer sind stolz auf ihre Helvetismen
In der Deutschschweiz wurden die Schüler aller Stufen bis vor kurzem darauf getrimmt, alle Helvetismen zu vermeiden und auch im innerschweizerischen schriftlichen Verkehr nur «Hochdeutsch» zu schreiben. Im Zuge eines verstärkten Schweizer Selbstbewusstseins (Stichwort: Swissness) und einer weniger normorientierten Sprachwissenschaft werden heute die Eigenheiten der in der Deutschschweiz geschriebenen Sprache stärker anerkannt. Man spricht nun von Schweizer Hochdeutsch bzw. von der Schweizer Standardsprache − in der Kurzform: Deutsch (CH). Entsprechendes gilt für das Französische und Italienische.
Die Hintergründe dieser Entwicklung sind weitreichend: Der Globalisierungsprozess hat zwar eine Vereinheitlichung auf der Ebene des Finanz- und Wirtschaftssystems gebracht, doch in kultureller Hinsicht ruft er auch Gegenreaktionen hervor. In der Schweiz zeigen sich diese in einer vermehrten Verwendung der Schweizer Dialekte im gesprochenen Wort, auf der Ebene der Schriftlichkeit in der Verwendung des Schweizer Hochdeutschen, Französischen und Italienischen. Die im Rahmen der Globalisierung auftretenden Migrationsbewegungen, in unserem Fall insbesondere die Einwanderung gut ausgebildeter deutscher und französischer Fachkräfte in die Schweiz, haben die Problematik verstärkt, die Sprache reagiert eben sehr sensibel auf gesellschaftliche Veränderungen.
Website sowohl in Deutsch als auch in Schweizer Hochdeutsch
Was heisst das für das Marketing und die entsprechenden Texte sowie deren Übersetzung? Fremdsprachige Texte dürfen nicht einfach ins Deutsche, Französische oder Italienische übertragen werden, sondern in die jeweilige Schweizer Variante – ein Anspruch, dem Ihr Sprachdienstleister gerecht werden muss! Auf Ihrer Website könnte eine DE- sowie eine DE (CH)-Variante der entscheidende Punkt sein, der Sie von der Konkurrenz abhebt. Die Besonderheiten der Deutschschweizer Standardsprache etwa reichen von der Orthografie (etwa die grundsätzliche Verwendung des Kommas als Dezimalzeichen, ausser bei Geldbeträgen, die Zeichensetzung, ein erhöhter Gebrauch des Fugen-s, des Doppel-S anstatt ß), über den Satzbau (auffallend sind verkürzte Hauptsätze) bis zum Wortschatz, der in zahlreichen Fällen von demjenigen in Deutschland abweicht, beispielsweise Rahm für Sahne, Cervelat- für Lokalprominenz, Spital für Krankenhaus, Leckerli für Lebkuchen.
Im Französischen weicht der Wortschatz im Bereich den politischen, wirtschaftlichen, institutionellen, gesundheitlichen Organisationen deutlich ab. Er bildet eine ganz neue Welt: In der Schweiz wird nach dem Bachelor eine Vielfalt von formations postgrades angeboten, während in Frankreich die Rede von Master oder 3e cycle ist. Und die maturité entspricht nicht der Reife, sondern dem französischen baccalauréat. Wurden Sie in einer division privée ou commune oder en chambre double ou particulière im Spital behandelt? Verfügen Sie über eine genügende Deckung bei der caisse maladie oder der sécurité sociale? Essen Sie Ihre Mittagsverpflegung dans votre office oder au bureau? Geht Ihr Kind zur école enfantine oder maternelle? Und im Tessin: Geht Ihr Kind ins asilo oder in die scuola dell’infanzia? Ohne extra-textuelles Wissen über die Schweiz (sprich Kultur, organisatorisches System usw.) kann sich der Übersetzer in diesem Dschungel schnell einmal verlieren.
Besser bei Google gefunden werden
Aufgrund der Frankenstärke wenden sich Schweizer oder ausländische Unternehmen für ihre deutschsprachigen bzw. französischen Übersetzungen für die Schweiz an deutsche bzw. französische Übersetzungsagenturen, was wegen des derzeitigen Wechselkurses geringere Kosten verursacht. Die Folgen daraus können für Ihr Unternehmen aber grössere Umsatzeinbussen bedeuten, denn liest ein Deutschschweizer in einem Marketingtext „Geldbeutel“ oder „Portmonee“ (der Duden empfiehlt diese Schreibweise für Deutschland), fühlt er sich möglicherweise bei diesem Text nicht angesprochen, oder er ärgert sich gar über die «fremde» Ausdrucksweise. Gefühle spielen im Marketing eine entscheidende Rolle, und sie werden über die Sprache vermittelt. Die Schweizer Kundinnen oder Bewerberinnen werden sich (beim Jobinserat) beleidigt fühlen, wenn die weibliche Form nicht automatisch vorkommt, was in Frankreich sogar in manchen Fällen als Fehler betrachtet wird (Cheffe in Fr-CH vs. Chef in Fr-FR).
In der jeweiligen Sprachvariante verwenden die Unternehmen Formulierungen entspannter, die etwa eine Nähe zu den Kunden ausdrückt. Dies geht zwar über das eigentliche Thema des Schweizer Hochdeutschen bzw. Französischen hinaus, ist bei Marketingtexten jedoch beim Übersetzen bzw. beim Texten zu berücksichtigen, wenn Ihr Unternehmen damit Erfolg haben will. Und: Wer auf seiner Website die Sprache des Kunden benützt, hat eine grössere Chance, bei Google gefunden zu werden. Denn wenn ein Kunde zum Beispiel „Rahm“ sucht, weiss er mit „Sahne“ nichts anzufangen. Übersetzen heisst eben nicht nur, einen Text von der Ausgangssprache in die Zielsprache zu «befördern», sondern es bedeutet auch, die Texte an die angesprochene Gruppe in der Zielsprache zu adaptieren. Ein guter Sprachdienstleister trägt diesem Umstand in der Schweiz Rechnung.
Autor: Roman Probst war Dipl. Kommunikator FH und CEO der TRANSLATION-PROBST AG. Die TRANSLATION-PROBST AG ist eine mehrfach ausgezeichnete Übersetzungsagentur und bietet Übersetzungen, Terminologie-Management, Textservice und Dolmetschen mit Qualitätsgarantie an.